




   |
 |
 |
| Foto:
Michael Bienert |
| Startseite |
PRINZESSINNEN IM SPIEGEL
Die Quadriga auf dem
Brandenburger Tor ist das bekannteste Werk des
Bildhauers Johann Gottfried
Schadow, in der aktuellen Ausstellung auf der Berliner
Museumsinsel aber wird
sie nur am Rande erwähnt. Das letzte runde
Schadow-Jubiläum ist schließlich
noch nicht lange her: Zum 250. Geburtstag vor acht
Jahren widmete das
Stadtmuseum dem Begründer der Berliner Bildhauerschule
des 19. Jahrhunderts die
letzte Retrospektive. In der Alten Nationalgalerie
dreht sich nun alles um Schadows
bis heute beliebtestes Werk, das lebensgroße
Doppelstandbild der preußischen
Prinzessinnen Luise und Friederike. „Bitte berühren“ steht unter dem weiß lackierten Tastmodell am Ausstellungseingang, das die beiden Prinzessinnen in zärtlicher Umschlingung zeigt. Wenn man dagegen klopft, klingt es metallisch und hohl. In ähnlicher Verkleinerung dienten die beiden Schwestern in der Alten Nationalgalerie auch schon mal als Tischdekoration, ausgeführt in weißer Schokolade anlässlich eines Festmahls. Wer hatte damals den Mut, einen der zarten Mädchenarme abzubrechen oder einen Prinzessinnenkopf abzubeißen? Nun hat die Museumspädagogik am Eingang der Schadow-Sonderausstellung eine Kulisse aufgestellt, vor der sich Kunstfreundinnen als „Doppelpack“ fotografieren lassen können: Die preußischen Prinzessinnen sollen auch die Insta- und Tiktok-Welt erobern! Wer zwei Etagen tiefer den
Kunsttempel auf der Museumsinsel betritt,
wird mit einem Schockmoment auf die Sonderschau unterm
Dach hingewiesen. Normalerweise
sind die beiden Prinzessinnen die Topstars in einer
Galerie mit marmorweißen Spitzenwerken
der Berliner Bildhauerschule, die auf den Parcours
durch die Malerei des 19.
Jahrhunderts einstimmt. An gewohnter Stelle steht nun
eine mattbunt
angestrichene Gipskopie der lebensgroßen
Mädchenfiguren wie aus einem billigen
Comic entsprungen. Ein Werk des Konzeptkünstlers
Hans-Peter Feldmann, der
Auratisierungsstrategien des Museumsbetriebs in seinen
Installationen immer neu
hinterfragt. Spieglein,
Spieglein an der Wand Die kostbare Marmorversion der
Prinzessinnengruppe findet
sich nun oben im Schinkelsaal zwischen zwei riesigen
Spiegelwänden. Die
Skulptur teilt sich den weiten Raum mit einer gleich
großen Gipsversion. Diese
diente als Vorlage für die später ausgeführte
Marmorskulptur. Die Spiegelwände erleichtern
die vergleichende Betrachtung von allen Seiten. In
dieser ernüchternden Ballettsaal-Atmosphäre
sieht man die beiden Prinzessinnen unendlich oft
dupliziert. Auch das ein
Angriff auf Seh- und Ausstellungsgewohnheiten. Man
kann das unendlich oft
reproduzierte Werk nicht anschauen, ohne mit dem
Phänomen seiner Vervielfältigung
konfrontiert zu sein. In einer Ecke des Saals stehen
Büsten der Prinzessinnen aus
Ton, Gips und Pappmaché, in einer Ecke anderen liegt
der Vertrag aus, den der
Hofbildhauer Schadow mit einem Kollegen geschlossen
hat, damit dieser die
Gipsfassung der Skulptur in Marmor übertrug. Die
endgültige Ausarbeitung vor
allem der Gesichter und der Mädchenarme behielt
Schadow sich vor. Was ist hier denn nun das
eigentliche Werk, was ist Original,
was Kopie? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt es
nicht. Die Gipsfassung
der Mädchengruppe verließ die Schadowsche
Bildhauerwerkstatt bereits 1795 und
wurde auf der alle zwei Jahren stattfindenden Berliner
Kunstausstellung in der
Akademie der Künste gezeigt. Die Gipse wurden also als
fertiges Werk präsentiert
und wahrgenommen. Sie waren damals eine Sensation.
Zwei Jahre später stellte Schadow
dann die vom König in Auftrag gegebene Marmorfassung
aus. Doch bereits die
lebensgroßen Gipsfiguren der Mädchen beruhten
zumindest teilweise auf 3-D-Reproduktionstechniken.
Ganz am Anfang des Prozesses stellte der Bildhauer
zwei Terrakottabüsten der
Mädchenköpfe nach der Natur her. Von diesen wurden
Gipsabgüsse genommen und
diese wiederum in die Ganzfiguren aus Gips eingebaut.
Ob die Prinzessinnen
selbst jemals in der gezeigten Pose Modell gestanden
haben, ist fraglich. Schöner in Gips Spieglein, Spieglein an der Wand,
welche ist nun die
schönste Prinzessin im ganzen Land? Der steinharte,
aber glatt polierte und
leicht transparente Marmor wirkt wie ein
Weichzeichner. Die Gipsfiguren sind nicht
weniger anmutig, trotz oder wegen ihrer rauhen
Oberfläche. Sie wirken nahbarer,
man sieht Spuren von Arbeit und Alterung des
Materials. Das macht die Figuren
noch berührender. Denn Gips ist fast so vergänglich
wie ein Mensch. In einem Nebenkabinett liegt
demonstrativ ein „Skulpturen-Blasebalg“
in einer Vitrine. Ein Werkzeug zum Wegpusten von
Staub, der sich auf den Gipsen
absetzt und ihn mit der Zeit alt aussehen lässt.
Feucht abputzen sollte man sie
besser nicht. Also wurden Gipsskulpturen früher gern
übermalt, um sie wieder
hell strahlen zu lassen. Eine Galerie von schwer
geschädigten Gipsbüsten aus
dem Depot demonstriert die Langzeitwirkung von
unsachgemäßen Restaurierungen. Auch
die Gipsprinzessinnen galten im Ergebnis als
unrestaurierbares Werk. In den
letzten drei Jahren wurden sie mit modernsten Methoden
behutsam dem Ursprungszustand
angenähert. Bis zu sieben
Farbschichten tupften Restauratorinnen mit
Wattebäuschen vom Gips des 18.
Jahrhunderts ab. Aus der Restaurierungswerkstatt geht der Blick zurück in Schadows Bildhaueratelier: Wie hat er gearbeitet, was ging in seinem Kopf vor? Mit der Prinzessinnengruppe schrieb er Kunstgeschichte: Sie gilt als erstes skulpturales Doppelporträt historischer Persönlichkeiten. Aber es gab Vorbilder. Von 1785 bis 1787 studierte der junge Schadow in Rom, daher kannte er die Darstellungen der Zwillingsbrüder Castor und Pollux aus der Antike. Ausgestellt sind auch Skulpturen von Frauenpaaren, die sich ähnlich umarmen wie die preußischen Prinzessinnen. Schadow zitiert diese Vorbilder verblüffend genau. Auch die Kinnbinde der Kronprinzessin Luise findet sich bereits bei der antiken „Zingerelle“, die zu Schadows Zeiten in der Villa Borghese ausgestellt war. Der Stoffwickel sollte, so schreibt er es selbst, eine unschöne Schwellung am Hals des Mädchens verdecken. Um 1800 wurde die Kinnbinde zum modisches Accessoire. Ein erotischer Skandal In der Nachahmung der Antike war
Schadow ebenso selbstbewusst wie
sein großer Berliner Zeitgenosse, der Architekt
Schinkel. Damit haben beide
Schule gemacht. Überlieferte Formen und Formeln hat
Schadow frei benutzt und
zeitgenössisch interpretiert. Seine Prinzessinnen im
antiken Gewand sind nicht
als griechische Mythologiewesen kostümiert. Ihre
adlige Herkunft spielen nur
insofern eine Rolle, als die ranghöherer
Kronprinzessin eine etwas aufrechtere
Haltung einnimmt. Die körperliche Intimität der
beiden Schwestern, ihre
Ungezwungenheit ist hier das Thema. Als von
gesellschaftlichen Fesseln befreite
Naturgeschöpfe scheinen sie ganz bei sich. Wenn
überhaupt eine Ideologie, dann
ist es die bürgerliche Verklärung der Natur, die
sich in den beiden
Mädchengestalten materialisiert. Der erotomanische Preußenkönig
Friedrich Wilhelm II. hatte kein
Problem damit, seine Schwiegertochter Luise in fast
durchscheinender Gewandung
den Blicken der Öffentlichkeit preiszugeben. Sein
Sohn, der Ehemann Luises,
ließ die Marmorskulptur nach seiner Krönung in einem
Winkel des Berliner
Stadtschlosses verschwinden. Nicht als die Sinne
reizendes Mädchen sollte Luise
nach ihrem frühen Tod im Gedächtnis bleiben, sondern
als liebende Ehefrau und
tapfere Kämpferin gegen Napoleon. Die Schwester
Friederike wurde wegen ihres
lockeren Lebenswandels vom Hof verstoßen. Erst 1906
war die Prinzessinnengruppe
wieder öffentlich ausgestellt. Schadows virtuose, an der Antike
geschulte Darstellung von
Ungezwungenheit machte trotzdem Schule in der
preußischen Bildhauerei des 19.
Jahrhunderts. Friedrich den Großen porträtierte er
nicht als Heros, sondern als
Spaziergänger mit seinen Windspielen. Die
Ausstellung zeigt zwei seltene Vorstudien
in Ton, sogenannte Bozetti, zu seinem berühmten
Denkmal des Generals von Zieten:
Die klassische Offizierspose ersetzte Schadow durch
die lebensnahe Haltung
eines Feldherrn, der grüblerisch den Kopf in die
Hand stützt, die Beine über
kreuz. Aus dem Heldenbild in antiker Manier wurde
ein Charakterbild. Schadow – ein Rassist? Auf der Suche nach Naturwahrheit widmete
sich Schadow intensiv
einer Pseudowissenschaft, der Phrenologie. Die
Schädelkunde war um 1800 groß in
Mode. Durch exakte Vermessung der Köpfe sollte ein
Rückschluss auf ihren
Inhalt, genauer den Charakter von Menschen möglich
sein. Schadow zeichnete und
vermaß Köpfe in verschiedenen Lebensaltern. Goethe,
von dem Schadow eine wenig
schmeichelhafte Porträtbüste schuf, lehnte dieses
Ansinnen dankend ab. Seine
Studien veröffentlichte Schadow unter dem Titel
„Polyclet“. Als Fortsetzung
erschien 1835 ein Band mit „National-Physiognomien“,
der nicht frei ist von
damals gängigen rassistischen Stereotypen. Auch die
Büste eines „Kaffers“ ist
in der Ausstellung zu sehen. Es handelt sich um das
Porträt eines
Südafrikaners, dessen Kopf als zoologisches Präparat
nach Berlin verschifft worden
war. Schadows ethnologisches Interesse belegen auch
Zeichnungen von den Köpfen
eines Chinesen, eines Hawaiianers, des türkischen
Botschafters in Berlin und
einer schwer übergewichtigen Schweizerin, die auf
Jahrmärkten auftrat. Die
Ausstellungstexte weisen explizit auf die Spuren von
Kolonialismus in diesen
Arbeiten hin, ohne den Künstler einem pauschalen
Rassismusvorwurf auszusetzen. Unter dem
Titel „Berührende Formen“ stellt die Ausstellung die
Schadowsche
Prinzessinnengruppe zuletzt den größeren Kontext der
Darstellung von
Geschwister- und Freundespaare seit dem 18.
Jahrhundert. Der 1764 in Berlin
geborene Bildhauer war ja nicht nur ein Kind des
Zeitalters der Aufklärung,
sondern auch der Empfindsamkeit und der
Freundschaftskulte. Hinreißende
Schwesternporträts des englischen Malers Thomas
Gainsborough belegen die
Zeitstimmung, aus der heraus Schadow die Bildnisse
junger Frauen geschaffen
hat. Johann Friedrich August Tischbein die
preußischen Prinzessinnen in
ähnlicher Haltung gemalt. Vom preußischen
Klassizismus zieht die Ausstellung
eine Linie bis zu einem queeren Porträt zweier
Freunde von Karl Hofer aus den
1920er-Jahren und bis zu einem Tänzerinnenpaar von
Gerhard Marcks in den
1930er-Jahren. Während Marcks sich explizit mit
Schadows Prinzessinnen
auseinandersetzte, ist bei einem Skulpturenpaar von
Henri Laurens nicht klar,
ob er sie gekannt hat. Wie auch immer: Alle diese
Werke sind auf einer
elementaren Ebene miteinander verwandt, denn sie
sprechen ein Urbedürfnis nach
körperlicher Nähe und intimer Verbundenheit zwischen
zwei Menschen an. Und so
bleibt, obwohl diese Ausstellung die schönen
Prinzessinnen auf den Seziertisch
legt, am Ende ein warmes Gefühl. Alte Natioonalgalerie, 21. 10. 2022
bis 19. 2. 2023 Weitere Informationen: https://schadowinberlin.de |
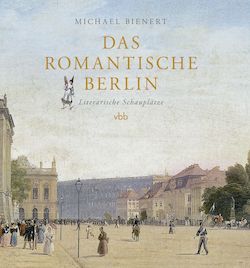 Michael Bienert DAS ROMANTISCHE BERLIN 184 Seiten, 171 Abb., Verlag für Berlin-Brandenburg, 25 € Mehr Infos |
| Stadtführungen | ||
| Bücher |
||
| Lesungen I Vorträge | ||
| Audioguides | ||
| Literatur
und
Kunst |
||
| Chamisso-Forum | ||
| Theaterkritiken | ||
| Ausstellungskritiken | ||
| Reisebilder |
||
| Denkmalschutz |
||
| Aktuelles im Blog |
||
 |
||
| Michael
Bienert |
||
| Elke Linda Buchholz |
||
| Impressum Datenschutz |
||
| Kontakt |
||
| Michael Bienert live erleben |
||