
NEUES MUSEUM DIE WIEDERERÖFFNUNG IM OKTOBER 2009
Nofretete ist zurück auf der Insel
Von Elke Linda Buchholz
Mehr als ein halbes Jahrhundert war das Neue Museum Kriegsruine. Jetzt ist das vom britischen Architekten David Chipperfield wiederhergestellte Bauwerk wieder als Museum zu erleben, als letztes der fünf historischen Häuser auf der Berliner Museumsinsel. Ein Kapitel der Nachkriegszeit geht damit glücklich zu Ende. Das Ägyptische Museum und das Museum für Vor- und Frühgeschichte sind in ihr Stammhaus zurückgekehrt. Doch nichts ist hier mehr so wie vor 150 Jahren, als das Neue Museum als Erweiterungsbau des Alten Museums eröffnet wurde.
 Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der
benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue
architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die
solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne
Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,
klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in
die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch
abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen
historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im
Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen
wirken?
Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der
benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue
architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die
solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne
Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,
klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in
die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch
abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen
historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im
Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen
wirken?
Das Kabinett der schönen Nofretete erreicht man durch den besterhaltenen Trakt, den Niobidensaal. Von der goldenen Deckenkonstruktion blicken antike Götter aus Wandbildern herab. "Es schuf Prometheus jede Kunst den Sterblichen" verkündet eine alte Inschrift. In langgestreckten Vitrinen rollt die Berliner Papyrussammlung, eine der bedeutendsten weltweit, hier die "Bibliothek der Antike" auf. Hieroglyphen-Romane und -Steuerquittungen, griechische Komödien und arabische Koran-Suren überdauerten im trockenen Wüstensand auf Papyrus, Pergament und Tontafeln. Flankiert werden die fragilen Schriftstücke durch Porträtköpfe antiker Dichter und Denker aus der Antikensammlung. Nicht nur hier bereichern und ergänzen solche Leihgaben kongenial die Präsentation der ägyptischen, vor- und frühgeschichtlichen Objekte.
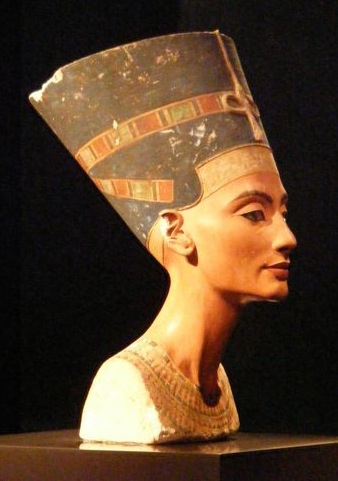 Nofretete
hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen
James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische
bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein
Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze
Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.
Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse
der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform
im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als
kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst
wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile
pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur
Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und
Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,
Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen
Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.
Nofretete
hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen
James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische
bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein
Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze
Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.
Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse
der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform
im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als
kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst
wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile
pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur
Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und
Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,
Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen
Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.
Großartig hingegen entfalten drei reliefgeschmückte Grabkammern aus der Pyramidenzeit ihre Wirkung, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu sehen waren. Die über und über mit fein gemeißelten Alltagsszenen von Bauern, Handwerkern, Tieren und Pflanzen verzierten Steinplatten stehen frei zugänglich im lichten Raum. Auf die ewige Existenz im Jenseits richtete sich die ägyptische Kultur aus.
Vom Musikinstrument bis zum Klapphocker, vom Schminkzeug bis zur Schale mit Früchten nahmen die Verstorbenen alles mit ins Grab, was der Mensch braucht. Die nie benutzten Gerätschaften für die Ewigkeit vermitteln ein lebendiges Bild der ägyptischen Alltagskultur. Allerdings muss man in den Keller hinabsteigen, um sie zu sehen. Auch die Mumien sind in die Unterwelt verbannt, wo sie unter niedrigen Ziegelgewölben eine fast beklemmende Wirkung entfalten.
Hoch und licht öffnen sich hier im Untergeschoss dagegen die beiden großen Höfe des Bauwerks, der Griechische und Ägyptische Hof, durch alle drei Geschosse bis zum verglasten Dach. Die Höfe bilden, wie Perlen an einer Schnur, einen Teil der Archäologischen Promenade, die künftig einmal alle Häuser der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbinden soll. Menschheitsthemen wie Weltordnung, Götterbild und Jenseits werden hier epochen- und kontinenteübergreifend angesprochen. Gewaltige, roh behauene Steinfiguren aus russischen Steppe begegnen der kolossalen Marmorstatue des Zeus aus Magnesia, afrikanische Ahnenfiguren einem abstrakten Götterstein des Hinduismus. Acht verschiedene Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben daran mitgewirkt.
 Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark
dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von
seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der
Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor
dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur
ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz
des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein
paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen
nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu
sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der
Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.
Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark
dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von
seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der
Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor
dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur
ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz
des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein
paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen
nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu
sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der
Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.
 Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des
Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte
durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum
Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer
Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile
der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und
schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken
Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur
der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in
den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die
Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten
erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der
römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie
die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des
Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte
durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum
Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer
Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile
der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und
schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken
Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur
der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in
den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die
Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten
erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der
römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie
die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.
Im obersten Stockwerk stößt man schließlich in die frühesten Epochen der Menschheit vor. Wer diesen Bereich des Hauses betritt, fühlt sich unversehens in ein völlig anderes Museum versetzt. Statt elegant-klassischer Vitrinen bestimmt hier eine moderne, kubische Ausstellungsarchitektur aus schlichtem Sperrholz das Bild und verlockt zu immer neuen Ein- und Ausblicken. Direktor Matthias Wemhoff, der vor zwei Jahren sein Amt antrat, nutzte die Chance, wenigstens hier neue Formen der Präsentation zu erproben. Welche Fische der Steinzeitmensch angelte, wie sein Gebiss beschaffen war und wie er von Afrika aus die Welt eroberte, zeigen jahrtausendealte Originalfunde flankiert von Dioramen, Computersimulationen und aufklappbaren Zeitleisten.
 Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus
Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein
Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,
sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln
mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man
staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.
Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während
sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit
informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in
dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt
genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,
der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.
Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus
Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein
Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,
sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln
mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man
staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.
Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während
sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit
informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in
dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt
genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,
der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.
Solch populäre Vermittlungsformen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Abteilung kontrastieren aufs Schärfste mit der auratisierten Kunst-Atmosphäre in den Räumen des Ägyptischen Museums. Zwei gegensätzliche Auffassungen, wie sich Kulturgeschichte und Kunst heute präsentieren lassen, prallen hier unter einem Museumsdach aufeinander. Doch sie schließen einander nicht aus. Vielmehr schaffen sie ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Miteinander von Ideen, Räumen und Zeiten. Tagelang könnte man hier verweilen, um das Zusammenspiel von Kunstwerken und Architektur zu genießen, immer neue Facetten und Bezüge zu entdecken. Jeder Saal hält neue Überraschungen bereit. Zeit und Kunst sind wandelbar, Museumskonzepte auch. Dies macht das Neue Museum auf großartige Weise erfahrbar.
Erstdruck: STUTTGARTER ZEITUNG vom 16. Oktober 2009
 © für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda
Buchholz
© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda
Buchholz
■ MEHR ÜBER DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IM NEUEN MUSEUM >>>
■ ZUM PORTRÄT DES ARCHITEKTEN DAVID CHIPPERFIELD >>>
■ DIALOGE O9 - SASHA WALTZ IM NEUEN MUSEUM >>>
Nofretete ist zurück auf der Insel
Von Elke Linda Buchholz
Mehr als ein halbes Jahrhundert war das Neue Museum Kriegsruine. Jetzt ist das vom britischen Architekten David Chipperfield wiederhergestellte Bauwerk wieder als Museum zu erleben, als letztes der fünf historischen Häuser auf der Berliner Museumsinsel. Ein Kapitel der Nachkriegszeit geht damit glücklich zu Ende. Das Ägyptische Museum und das Museum für Vor- und Frühgeschichte sind in ihr Stammhaus zurückgekehrt. Doch nichts ist hier mehr so wie vor 150 Jahren, als das Neue Museum als Erweiterungsbau des Alten Museums eröffnet wurde.
 Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der
benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue
architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die
solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne
Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,
klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in
die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch
abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen
historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im
Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen
wirken?
Schon bevor man das Neue Museum über den arkadengesäumten Vorplatz der
benachbarten Alten Nationalgalerie betritt, eröffnen sich ganz neue
architektonische Räume. Befreit von Bauzäunen verbinden sich die
solitären Museumsbauten endlich wieder zu einem Ensemble. Das moderne
Treppenhaus Chipperfields nimmt den Besucher im Inneren mit großer,
klarer Geste in Empfang. Unwiderstehlich ist der Impuls, sogleich in
die Bel Etage emporzusteigen und der Nofretete einen Besuch
abzustatten. Die Spannung ist groß: Wie werden die teilweise erhaltenen
historischen Räume mit ihren Fresken, Säulen und Kuppeln im
Zusammenspiel mit den bronzezeitlichen Urnen und ägyptischen Skulpturen
wirken?Das Kabinett der schönen Nofretete erreicht man durch den besterhaltenen Trakt, den Niobidensaal. Von der goldenen Deckenkonstruktion blicken antike Götter aus Wandbildern herab. "Es schuf Prometheus jede Kunst den Sterblichen" verkündet eine alte Inschrift. In langgestreckten Vitrinen rollt die Berliner Papyrussammlung, eine der bedeutendsten weltweit, hier die "Bibliothek der Antike" auf. Hieroglyphen-Romane und -Steuerquittungen, griechische Komödien und arabische Koran-Suren überdauerten im trockenen Wüstensand auf Papyrus, Pergament und Tontafeln. Flankiert werden die fragilen Schriftstücke durch Porträtköpfe antiker Dichter und Denker aus der Antikensammlung. Nicht nur hier bereichern und ergänzen solche Leihgaben kongenial die Präsentation der ägyptischen, vor- und frühgeschichtlichen Objekte.
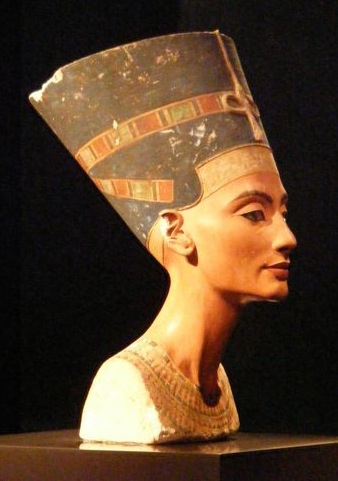 Nofretete
hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen
James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische
bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein
Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze
Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.
Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse
der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform
im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als
kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst
wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile
pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur
Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und
Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,
Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen
Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden.
Nofretete
hält hoheitsvoll unter der historischen Nordkuppel Hof. Nur der Mäzen
James Simon, der ihre Ausgrabung 1912 finanzierte, darf in einer Nische
bei ihr weilen. Eigentlich ist die weltberühmte Büste ein
Bildhauermodell aus Kalkstein, überzogen mit bemalten Stuck. Eine ganze
Künstlerwerkstatt gruben die Berliner Archäologen damals in Amarna aus.
Die teils unvollendeten, manchmal erstaunlich realistischen Bildnisse
der Königsfamilie Echnatons erhalten nun auf der verglasten Plattform
im Ägyptischen Hof eine geradezu transzendentale Präsenz. Nicht als
kulturgeschichtliches Zeugnis, sondern als reine, überzeitliche Kunst
wollte der für das Ausstellungskonzept verantwortliche, mittlerweile
pensionierte Direktor Dietrich Wildung die ägyptische Skulptur zur
Geltung bringen. Zum Teil jedoch wirken die Pharaonen- und
Göttergestalten mit ihren über Jahrtausende perfektionierten Schreit-,
Sitz- und Standmotiven wie gefangen in den großen, dreidimensionalen
Metallumrahmungen, in denen sie präsentiert werden. Großartig hingegen entfalten drei reliefgeschmückte Grabkammern aus der Pyramidenzeit ihre Wirkung, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht zu sehen waren. Die über und über mit fein gemeißelten Alltagsszenen von Bauern, Handwerkern, Tieren und Pflanzen verzierten Steinplatten stehen frei zugänglich im lichten Raum. Auf die ewige Existenz im Jenseits richtete sich die ägyptische Kultur aus.
Vom Musikinstrument bis zum Klapphocker, vom Schminkzeug bis zur Schale mit Früchten nahmen die Verstorbenen alles mit ins Grab, was der Mensch braucht. Die nie benutzten Gerätschaften für die Ewigkeit vermitteln ein lebendiges Bild der ägyptischen Alltagskultur. Allerdings muss man in den Keller hinabsteigen, um sie zu sehen. Auch die Mumien sind in die Unterwelt verbannt, wo sie unter niedrigen Ziegelgewölben eine fast beklemmende Wirkung entfalten.
Hoch und licht öffnen sich hier im Untergeschoss dagegen die beiden großen Höfe des Bauwerks, der Griechische und Ägyptische Hof, durch alle drei Geschosse bis zum verglasten Dach. Die Höfe bilden, wie Perlen an einer Schnur, einen Teil der Archäologischen Promenade, die künftig einmal alle Häuser der Museumsinsel unterirdisch miteinander verbinden soll. Menschheitsthemen wie Weltordnung, Götterbild und Jenseits werden hier epochen- und kontinenteübergreifend angesprochen. Gewaltige, roh behauene Steinfiguren aus russischen Steppe begegnen der kolossalen Marmorstatue des Zeus aus Magnesia, afrikanische Ahnenfiguren einem abstrakten Götterstein des Hinduismus. Acht verschiedene Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben daran mitgewirkt.
 Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark
dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von
seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der
Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor
dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur
ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz
des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein
paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen
nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu
sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der
Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.
Keine der Sammlungen wurde durch den Zweiten Weltkrieg so stark
dezimiert, wie das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das nun von
seinem peripheren Standort in Charlottenburg wieder ins Zentrum der
Berliner Museumslandschaft gerückt ist. Von 300 000 Inventarnummern vor
dem Krieg blieben durch Bombenschäden und Beutekunstverschleppungen nur
ein Drittel übrig. Der von Heinrich Schliemann ausgegrabene "Goldschatz
des Priamos" lagert noch immer im Moskauer Puschkin-Museum. Nur ein
paar Silbergefäße aus dem Troja-Schatz kehrten auf verschlungenen Wegen
nach Berlin zurück und sind nun erstmals seit dem Krieg dauerhaft zu
sehen. Die in Repliken gezeigten Goldfunde mahnen die Rückgabe der
Originale an, die den kostbarsten Schatz des Museums bildeten.  Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des
Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte
durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum
Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer
Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile
der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und
schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken
Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur
der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in
den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die
Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten
erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der
römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie
die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten.
Das Museum für Vor- und Frühgeschichte bespielt den Südflügel des
Hauses auf drei Etagen. Die 40 000 Jahre Menschheitsgeschichte
durchstreift man hier vom Neanderthaler-Schädel bis zum
Mittelalter-Schwert, allerdings nicht in streng chronologischer
Ordnung. Vielmehr greift der Parcours die Stimmungen, Themen und Stile
der historischen Museumsräume auf. Abgeblätterte Wandflächen und
schrundige, kriegsbeschädigte Säulen verbreiten im Saal des antiken
Zypern eine raue Ruinenatmosphäre. Eine passende Kulisse für die Kultur
der römischen Provinzen, die vom Soldatenhelm bis zum Salbfläschchen in
den Vitrinen präsentiert wird, bieten im "Römischen Saal" die
Wandbilder antiker Städte. Mit einer Fülle von Objekten und Aspekten
erzählt die Ausstellung, wie unsere germanischen Vorfahren der
römischen Kultur begegneten, wie aus Germanen Christen wurden und wie
die Slawen sich auf Berliner Territorium ansiedelten. Im obersten Stockwerk stößt man schließlich in die frühesten Epochen der Menschheit vor. Wer diesen Bereich des Hauses betritt, fühlt sich unversehens in ein völlig anderes Museum versetzt. Statt elegant-klassischer Vitrinen bestimmt hier eine moderne, kubische Ausstellungsarchitektur aus schlichtem Sperrholz das Bild und verlockt zu immer neuen Ein- und Ausblicken. Direktor Matthias Wemhoff, der vor zwei Jahren sein Amt antrat, nutzte die Chance, wenigstens hier neue Formen der Präsentation zu erproben. Welche Fische der Steinzeitmensch angelte, wie sein Gebiss beschaffen war und wie er von Afrika aus die Welt eroberte, zeigen jahrtausendealte Originalfunde flankiert von Dioramen, Computersimulationen und aufklappbaren Zeitleisten.
 Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus
Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein
Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,
sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln
mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man
staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.
Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während
sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit
informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in
dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt
genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,
der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet.
Das berühmte Spitzenstück der Sammlung, ein bronzezeitlicher Hut aus
Gold, erstrahlt in einem Kabinett unterm historischen Sterngewölbe, ein
Solitär wie die Nofretete. Doch dieser Hut ist nicht nur magisch schön,
sondern auch klug: Zierliche Kreis- und Spiralornamente verschlüsseln
mathematisches Wissen über die Zyklen von Sonne und Mond, wie man
staunend erfährt. Unweit davon duftet es nach Fellen und frischem Holz.
Hier dürfen Kinder Steinzeitwebstuhl und Holzbohrer erproben, während
sich die Eltern nebenan über die aktuellen Aspekte des Themas Eiszeit
informieren. Ein lange im Depot schlummerndes Elchgerippe darf in
dieser publikumsfreundlichen Ausstellung seinen großen Auftritt
genießen, ebenso wie ein ausgestopfter Steinzeitmenschen im Fellgewand,
der gerade ein weibliches Idol aus Ton knetet. Solch populäre Vermittlungsformen in der Vor- und Frühgeschichtlichen Abteilung kontrastieren aufs Schärfste mit der auratisierten Kunst-Atmosphäre in den Räumen des Ägyptischen Museums. Zwei gegensätzliche Auffassungen, wie sich Kulturgeschichte und Kunst heute präsentieren lassen, prallen hier unter einem Museumsdach aufeinander. Doch sie schließen einander nicht aus. Vielmehr schaffen sie ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Miteinander von Ideen, Räumen und Zeiten. Tagelang könnte man hier verweilen, um das Zusammenspiel von Kunstwerken und Architektur zu genießen, immer neue Facetten und Bezüge zu entdecken. Jeder Saal hält neue Überraschungen bereit. Zeit und Kunst sind wandelbar, Museumskonzepte auch. Dies macht das Neue Museum auf großartige Weise erfahrbar.
Erstdruck: STUTTGARTER ZEITUNG vom 16. Oktober 2009
 © für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda
Buchholz
© für Text und Fotos: Michael Bienert und Elke Linda
Buchholz
■ MEHR ÜBER DIE VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IM NEUEN MUSEUM >>>
■ ZUM PORTRÄT DES ARCHITEKTEN DAVID CHIPPERFIELD >>>
■ DIALOGE O9 - SASHA WALTZ IM NEUEN MUSEUM >>>
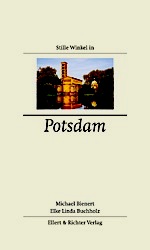
Michael Bienert
Elke Linda Buchholz
Stille Winkel in
Potsdam
Ellert & Richter Verlag
Hamburg 2009
ISBN:
978-3-8319-0348-1
128 Seiten mit 23 Abbildungen und Karte Format: 12 x 20 cm; Hardcover mit Schutzumschlag
Preis: 12.95 EUR
Elke Linda Buchholz
Stille Winkel in
Potsdam
Ellert & Richter Verlag
Hamburg 2009
ISBN:
978-3-8319-0348-1
128 Seiten mit 23 Abbildungen und Karte Format: 12 x 20 cm; Hardcover mit Schutzumschlag
Preis: 12.95 EUR
